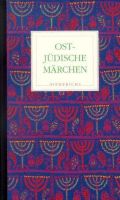Vor dem letzten Augenblick
Erzählungen aus verschwiegenen Zeiten
Manchmal denke ich wieder an Corona, wo einst alles seinen Anfang nahm. Corona, das ist die Stadt im Osten – oder auch im Süden, im fernen Transsilvanien, beinahe schon am Balkan, jedenfalls an den Karpaten, die, je nach Laune, drohend oder wohlwollend herabblicken auf die Menschen, die zu ihren Füßen wohnen und in geräumigen Tälern unterwegs sind.
Corona, in deren erstarrtem Herz immer noch hoheitsvoll eine gotische Kirche steht, geschwärzt vom Rauch vergangener Zeiten, Corona oder Kronstadt, die hochmütige, kühle, steinerne Frau im Zinnetal, liegt da seit Jahrhunderten und hält ihre schmalen Schenkel wie ehedem zur Ebene hin leicht geöffnet, vor sich hin dösend mit leisem Atem, vom Zeitgeschehen immer wieder beglückt oder auch vergewaltigt und danach jedes Mal vergessen. Corona ist eine Stadt, wo ehemals meist Siebenbürger Sachsen wohnten.
Ihre Ahnen waren, erzählt die Sage, einst dem Rattenfänger von Hammeln und seinem Flötenspiel gefolgt. Der führte sie dann durch eine lange, dunkle Höhle. Und als sie diese am anderen Ende wieder verließen, befanden sie sich plötzlich im fernen Transsilvanien, wo gerade die Sonne schien und die stillen, weiten Wiesen blühten. Das war vor mehr als achthundert Jahren.
Doch später kamen dann andere Rattenfänger, und die führten sie eines Tages aus dem schönen Land, wo man sich inzwischen wohnlich eingerichtet hatte, wieder hinaus. Zurück dahin, von wo man am Anfang der Geschichte ausgewandert war.
Und wieder ließen diese Sachsen alles stehen und liegen: Sie waren einst von Rhein und Mosel, aus Luxemburg und Flandern und auch von anderswo als Auswanderer fortgezogen und mit nichts hergekommen, um das wüste Land urbar zu machen, zu besiedeln und gegen Osmanen und andere Feinde zu verteidigen. Und nun verließen sie, wieder als Auswanderer, mit nichts ihre alte Heimat vom Rande der Karpaten. Das heißt, sie nahmen nur ein paar Koffer mit und einen Sack voll Erinnerungen. Irgendwann wurden dann die leeren Koffer entsorgt, und die Erinnerungen langsam vergessen. Weil jene, die noch in den Erinnerungen beheimatet waren, inzwischen diese Welt verlassen hatten.
Heute findet man noch an manchen Orten das schweigsame Andenken an dieses seltsame Volk voll Widersprüchen und Dünkel, das es nun dort so nicht mehr gibt und anderswo nicht mehr geben wird. Auch wenn ihre Türme und Stadtmauern immer noch dastehen als selbstbewusste Mahnmale.
Denn als die Sachsen fortzogen, haben sie ihre Türme und Kirchenburgen nicht mitgenommen. Die blieben zurück wie stumme Klagemauern einer immer wieder renovierten Vergangenheit, die man nun aus der Ferne heimattreu verwaltet. Und so werden manchmal auch Neid und Hass traditionsbewusst weiter mitgepflegt. Doch nun als artgerechte Würze in einer virtuell rekonstruierten Kirchenburg. Und so ist man auch wieder, wie einst, ganz unter sich.
Wer heute in Corona das enge Tal hochfährt, kommt bald in verschwiegene Gassen, wo engbrüstige Bürgerhäuser stehen, mit müden Gesichtern, von denen sich langsam die farbige Schminke löst, deren Dachfenster aber immer noch wie wachsame Augen, neugierig und misstrauisch, einander betrachten. Sie haben die Zeiten überdauert, weil die Zeiten an ihnen einfach vorbei gegangen sind, ohne sie zu beachten.
In dieser Stadt lebte einst ein Mädchen, und das steht jetzt am Anfang der Erzählung. Auch wenn es nicht durch das Tor der Kindheit die Erinnerung betreten hat. Denn sieben Tore hat die Erinnerung, heißt es in der karpatischen Volksmythologie. Durch das Erste betritt man das Leben und geht mit vielen kleinen Schritten durch die Kindheit, und das Siebte führt einen dann unausweichlich und mit raschen Schritten wieder hinaus.
Dieses Mädchen war, meine ich, ganz anders als die meisten Mädchen jener Jahre, und eigentlich passte es nicht in den Alltag der argwöhnischen, kühlen Corona. Vielleicht wohnte es auch deshalb in einem kleinen gelben Gartenhaus oben auf dem Raupenberg und nicht in der ungelüfteten Innenstadt, hinter Fenstern mit schweren Gardinen, vor denen sogar der Himmel halt macht. Dieses Mädchen, mit dem ich einen Sommer lang zusammen war, hatte dunkles krauses Haar und eine sanfte, helle Haut, weil es nie in der Sonne saß, und manchmal trug es einen großen flachen Strohhut. Und wenn man mich heute fragen würde, ob jenes Mädchen schön war, müsste ich sagen: ich weiß es nicht.
Doch dann öffnet sich zögernd das erste Tor zur Erinnerung. Und ich sehe sie wieder, wie sie in ihrem Garten der Schaukel sitzt, die am Ast eines alten Baumes hängt, und wie sie sich ein paar Mal vom Boden abstößt und sich dann wie ein Pendel zu wiegen beginnt. Dabei bewegt sie schwungvoll die Beine. Und jedes Mal, wenn sie mir entgegen fliegt, hebt sich rasch ihr weiter Rock ein wenig hoch, und sie wirft mir ein kleines Lächeln zu. (…)
(Aus: Vor dem letzten Augenblick. Erzählungen aus verschwiegenen Zeiten. Hans Boldt Literaturverlag: Winsen/Luhe, 2012; Winsener Heft, 35)
Blumenkind 
VORBEMERKUNG
Ein Blumenkind ist ein Liebeskind.
Und ein Liebeskind ist ein Kind, das aus einer Liebesbeziehung geboren wird.
Die Rumänen nennen ein solches Kind „copil din flori“, eben Blumenkind. Diese poetische Bezeichnung rührt wohl daher, heißt es, daß solche Kinder oft im Sommer auf einer Wiese mit Blumen gezeugt werden. Ob das nun richtig ist, darüber gehen die Meinungen selbstverständlich auseinander. Denn die Ambiente der Blumenwiese allein tut es noch nicht. Und auch nicht die Jahreszeit und das warmherzige Wetter. Außerdem lassen sich Gefühle und Leidenschaften nicht vorprogrammieren, einordnen und somit auch nicht auf diese Weise definieren.
Sie sind plötzlich einfach da, ungerufen und verwirrend, und fliegen eines Tages wieder fort. Und sie sind wie die Vögel, die in der Luft keine Spur hinterlassen. (Es sei denn, es kommt ein Blumenkind zur Welt.) Bei den Zipsern – einer kleinen Ethnie am Rande der rumänischen Waldkarpaten – nennt man das „tie wildi Lieb“. Diese „wilde Liebe“ aber ließe sich vielleicht am ehesten mit dem Begriff „freie Liebe“ in unsere zeitgenössische Sprache übertragen. Doch da haben wir schon, salopp gesagt, ein Problem – mit dem indogermanischen Adjektiv „frei“, verwandt mit „Freund“ und „Frieden“, ein Wort, das im letzten Jahrhundert so oft gebraucht und mißbraucht wurde, das man sich nur wundern kann, wieso es immer noch da ist. Die „wildi Lieb“ aber entzieht sich jedem Zugriff dieser Art, sie treibt ihr Spielchen nach eigenen Regeln.
Diese ungewöhnliche Liebesgeschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Und die Begegnungen und Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen haben sich tatsächlich so zugetragen. Sie sind ein Teil des Zeitgeschehens, wenn auch nur am Rande der großen Ereignisse, auf die hier gelegentlich hingewiesen wird. Verändert wurden manchmal einige Namen von Menschen und Orten, um die Lebenden zu schützen und um das Andenken jener, die diese Welt verlassen haben, nicht zu schädigen.
Denn hier wird berichtet von der Begegnung zweier Menschen, die sich zuerst fremd waren, weil das Schicksal es so wollte, und die sich dann liebten, weil es ebenfalls jenes unfaßbare Schicksal so eingerichtet hatte. Doch wer bestimmt eigentlich den Lauf der Dinge? Und warum laufen diese manchmal in so seltsame Richtungen? Fragen, die wir nicht beantworten können. Und auch Beila, eine der beiden Frauen, die hier erscheinen, hat darauf keine Antwort gefunden. Und Maria, ihr Blumenkind, hat darüber erst gar nicht nachgedacht. Und Ambros hat nie erfahren, daß er eigentlich auch ein Blumenkind* ist. Und so war seine Liebe nicht „wild“ sondern nur ungewöhnlich, einmalig und schicksalhaft, könnte man sagen.
(Aus: Blumenkind. Roman. SchirmerGraf: München, 2009)
Stunde der Wahrheit
Die Hunde im Bărăgan
Früher…
Früher war alles viel einfacher, denn damals gab es noch die Abhörgeräte, die kleinen, unsichtbaren, jeder sprach davon, doch eigentlich hatte noch nie jemand so ein Ding gesehen. Man spürte es aber: sie waren überall.
Damals trug auch ich so ein kleines Abhörgerät in mir, und das war mein Abhörgerät, denn ich empfand es nicht als einen Fremdkörper, ich hatte es selbst irgendwann installiert, und es gehörte keiner Behörde, von der es hieß, sie würde solche Geräte überall einbauen, („pisst nicht in die Lampenschirme, die Mikrophone könnten rosten“, hatte damals ein Freund gesagt, der in solchen Dingen bescheid wusste).
Das kleine Abhörgerätchen gehörte tatsächlich nur mir, und es war auch nicht „weiterverbunden“, ich allein hörte es ab, und so erfuhr ich jedes Mal auf wundersame Weise, was ich falsch machte, wann ich bei einem Gespräch zu wenig gesagt hatte, wann zu viel, wann ich hätte mehr schweigen sollen und wann mehr reden, mich vielleicht sogar zu Worte melden, zu etwas Stellung nehmen, wie es damals hieß.
All das erfuhr ich durch mein Abhörgerät, das ich mit mir durch den Alltag trug wie eine Warze im Gesicht – denn auch das Spiel der Mienen richtete sich oft, ferngesteuert, nach dem, was mir vorbeugend eingeflüstert wurde –, doch eine Warze sieht man, davon kann ich was erzählen, das Abhörgerät aber war nicht zu erkennen, wobei man annehmen darf, dass es eine Vielfalt von Geräten dieser Art gab, und jeder horchte für sich und in sich allein hinein; eine gewisse Individualität gab es auch da.
Nun, mit dem Verzicht auf die rumänische Staatsbürgerschaft, einer Fußkette, die mich ein halbes Jahrhundert durchs Leben begleitete, habe ich auch mein Abhörgerät verloren. Ich habe es in Bukarest, in der stillen Strada Sandu Aldea liegen lassen, wie man den Morast von den Schuhen am Fußabstreifer liegen lässt, und das war – denke ich manchmal heute, rückblickend und rückwertend, wenn ich am Rande des Massengrabes Alltag stehe und weiß, niemand wird mich da hineinstoßen, doch auch niemand wird mich durch eine kleine Geste davor bewahren, selbst hineinzufallen –, das war, denke ich trotzdem, vielleicht unvorsichtig und unklug, die „innere Zensur“ – nicht angeboren, doch anerzogen, jedenfalls angenommen –, diese vorsichtige Mutter aller sprachlichen Porzellankisten, so einfach abzugeben an die Vergangenheit.
Wie nützlich wäre es, wenn ich manchmal hier und heute wieder so ein kleines Abhörgerätchen hätte, vielleicht eine technisch verfeinerte Ausgabe des einstigen aus Rumänien, ein Gerät, das einem manches verbietet und immer rät, wie man sich zu verhalten hat im Lande der Lächler und Blender, ein treuer Begleiter, der in schwierigen Situationen einem nicht nur zur Seite steht sondern sogar in einem selbst ist, ein integriertes Gerät, wie es besser nicht sein könnte. Das wünschte man sich als einer, dem das wie durch Knopfdruck herbeigerufene Lächeln immer noch sichtlich schwer fällt, als einer, der meint, er müsse eigentlich nicht lächeln, wenn er nicht lächeln will. Doch so einfach ist das tatsächlich nicht.
Denn es ist jemand da, und ich höre ihn sprechen, leise, eindringlich, befehlend, und der sagt immerzu: Du musst endlich zum Mehrheitsvolk gehören, du musst dich integrieren, du musst auf die Anderen zugehen, auch wenn sie dir zuerst den Rücken zeigen; steh dann so lange hinter ihrem Rücken, bis sie dir vielleicht doch Beachtung schenken, dich in irgendeiner Weise zur Kenntnis nehmen, dich sogar akzeptieren. Dann ist der großen Augenblick gekommen, dann musst du überzeugend lächeln, dir ihre Sitten aneignen, dich daran gewöhnen wie an einen neuen Anzug, denn du sollst in keiner Weise unangenehm auffallen.
Du darfst nicht mehr einer sein, der hinzugekommen ist, der Erinnerungen nachhängt, die nicht aus deinem heutigen Umfeld stammen, der sich vielleicht sogar in solchen Erinnerungen vorübergehend einrichtet, wie in einem geistigen Übergangslager. Tritt heraus aus dem Getto, leg die alten Schuhe ab, zieh neue an, auch wenn sie drücken und unbequem sind, wirf den Schlüssel der Vergangenheit in den Brunnen deiner Märchen, nimm endlich die Freiheit an, die dir hier geboten wird!
Und da merke ich, wie der Boden unter meinen Füßen nachgibt, weil ich doch zu nahe am Rande der Grube gestanden habe, und ich gleite hinab, und das Gleiten ist beinahe so schön wie das Fliegen – nur geht es leider in die andere Richtung.
Doch das Zögern, ein Geschenk anzunehmen, das man mir auf den Geburtstagstisch meiner Einbürgerung gestellt hat, das Zögern hat so seine Gründe, und die wiegen oder sie wiegen nicht, je nachdem mit was für einer Waage man sie zu ergründen versucht. Denn ich glaube immer noch, wir Ostmenschen sind wie jene Hunde in den rumänischen Bauernhöfen am Rande der Bărăgan-Steppe, wo es lange Lattenzäune zur Straße gibt.
Die Hunde laufen täglich viele Male am Zaun entlang, weil hier ihr Freiraum endet. Doch wenn man dann einmal ein Türchen öffnet und sie hinaus lässt auf die Straße, zögern sie und können sich in dieser grenzenlos scheinenden Freiheit nicht bewegen.
So bleiben sie meist vor ihrem Tor sitzen und sehen zu, wie andere Hunde, die aus der nahen Stadt kommen und keinen Zaun kennen, vorbeigehen, mitten auf der Straße, vornehm, gepflegt und frei, an einer Leine, die man verlängern, aber auch wieder einziehen kann.
(Aus dem Band Stunde der Wahrheit. Erzählungen. Literaturverlag Hans Boldt: Winsen/Luhe, 2007. Erstveröffentlichung: ndl. Neue Deutsche Literatur, Berlin, 51/549, 3/2003, S. 47-49.)
Im selben Band ist auch die Erzählung „Das siebenbürgische Dorf“ erschienen, die bereits 2004 in rumänischer Übersetzung von Cosmin Dragoste in der Kulturzeitschrift ARGOS veröffentlicht wurde. Untenstehend die rumänische Fassung mit einem Vorspann von Cosmin Dragoste.
Revista de cultura ARGOS
08.05.2004, pag. 61-64
Continuand munca programatica pe care mi-am propus-o, aceea de recuperare a identitatii noastre reale, il prezint in acest numar din ARGOS pe Dr. Claus Stephani, intelectual de o inalta tinuta morala, rafinat, un exemplu de atitudine ce ar trebui sa-i anime pe toti oamenii dedicati spiritului. Nascut la Brasov pe 25.7.1938 si plecat in Germania in 1990, Dr. Claus Stephani a publicat numeroase carti la edituri de prestigiu din Romania, dar si din Germania, Elvetia sau Italia. I-au fost decernate premii literare romanesti si germane. Articole semnate de domnia-sa au aparut in “Frankfurter Rundschau”, “Jüdische Rundschau” (Basel), “Neue Zürcher Zeitung”, “Israel Nachrichten” (Tel Aviv), precum si in reviste din Germania sau Austria. Dr. Claus Stephani este o personalitate de prim rang, ce trebuie sa isi primeasca locul cuvenit in cadrul culturii noastre, acest lucru fiind valabil si pentru alti scriitori plecati din tara, necunoscuti la noi, unde pseudovalorile primeaza, dar recunoscuti pe plan international. Prin orice mijloace trebuie sa contribuim la renormalizarea axiologica a culturii noastre.
***
Satul transilvan de Claus Stephani
Traducere de Cosmin Dragoste
De pe strada principala un drum lateral duce in vale, ocolind campuri obosite, de pe care inca nu s-a strans recolta, cu toate ca toamna deja incepe sa ia totul in stapanire, in intreaga splendoare a culorilor sale, pe langa baltoace perfide, in care se vede o bucata de cer, si pe care le ocolim incet, pe langa case cu ferestre batute in cuie, pe langa un card de gaste, care ne taie calea tipand si batand din aripi.
Am oprit in fata bisericii care statea acolo neajutorata, unde, la intrare, buruienile cresc din belsug. Suntem in Birkendorf. O tacere adanca domneste peste acest loc. Este ora douasprezece ziua, insa ora aratata de ceasul din turn este mai tarzie, desi ar putea fi si mai devreme. Si asa nu se stie daca ea s-a oprit din fuga timpului intr-o dimineata sau intr-o seara.
Ne asezam pe o treapta de piatra, peste care, odinioara, se intra in biserica. Multi pantofi si cizme au batatorit in mijlocul ei o poteca lata. Sus, pe turn, ale carui ferestre inguste se holbeaza-n vale ca niste ochi de bufnita, undeva, sus, porumbeii stau la taclale, in iarba inalta si uscata taraie greieri singuratici si pare ca in Birkendorf nu locuieste nimeni in afara de gaste, greieri si porumbei.
Atunci, dintr-o casa, care inca mai este locuita, iese un tanar scund si negricios, priveste in juru-i si, cand ne observa, se apropie repede.
“Buna ziua. Pe cine cautati?”
“Buna ziua. Mai sunt inca sasi in satul asta?”
“Nu. Numai batrana Gagesch, invatatoarea. Va arat unde locuieste.”
Intr-o fundatura, lateral fata de biserica, la o casa unde atarna la ferestre perdele alb-albastre, batem la usa, deschidem poarta si intram in curte. Aici sunt flori, dalii, bobitei, ochiul-boului stralucitoare iar in spate, in curte, canta un cocos. Chiar si un catelus alb apare deodata, latra nervos de la o distanta in care se simte in siguranta, se apropie putin, dar se retrage imediat.
O femeie iese din casa, striga: “Cuminte, Hansi!”. Apoi coboara incet treptele de lemn, se observa ca este surprinsa, poate ca si bucuroasa si emotionata, mainile ii tremura cand se sprijina de balustrada. “Mars”, spune ea in dialectul sasesc, apoi in germana: “Pe cine cautati?”
“Pe sasii care au locuit aici odinioara”, am replicat eu si stiu ca acest raspuns suna ca un non- sens.
Doamna Gagesch ne pofteste in casa. Stam in odaia buna, sufrageria si acolo inca mai atarna cateva urcioare taranesti vechi, stergare cu inscriptii brodate, lana neagra pe tesatura alba, “Dumnezeul nostru este o cetate intarita” cu litere gotice, fotografii vechi in rame sculptate cu frunze de stejar, o fotografie de la nunta, o tanara cu cozi lungi si cu o agrafa, cu o brosa rotunda grea pe piept, doamna Gagesch mireasa, langa ea un tanar cu parul pieptanat in carare, amandoi in strai de sarbatoare. Ei privesc rigid si ceremonios spre o viata, al carei curs inca nu-l banuiesc.
“Barbatul meu. Nu s-a mai intors din razboi, am fost casatoriti numai sase luni, n-am avut copii si acum sunt singura”, spune doamna Gagesch, ca si cand ar zice ca maine va ploua si totul se aude ca si cand ar fi spus des aceste cuvinte, ori de cate ori priviri straine s-au indreptat spre tablou.
Pe fata de masa brodata se afla un servetel, pe el sta o farfurie adanca de portelan. Doamna Gagesch tocmai se pregatea sa ia masa de pranz. Este de la sine inteles ca suntem oaspetii ei; mai aduce doua servetele si doua farfurii. Apoi spune rugaciunea de la vremea mesei, fiindca masa inca mai este ceva sfant. Domnul Iisus trebuie sa fie oaspetele nostru si sa binecuvanteze ceea ce ne-a daruit. Adica o supa de rosii cu orez, pe langa aceasta o felie neagra de paine taraneasca.
Dupa supa sorbita pios si in tacere, vorbim despre timpurile trecute, caci prezentul il cunoastem- a mers pe ulite, a locuit in casele goale unde si-a lasat urmele pe acolo, iar un viitor nu va mai exista in Birkendorf, pentru ca prezentul este aici si viitor.
Intreb de cativa oameni care au trait aici odinioara si pe care i-am cunoscut. “Simon a murit acum sapte ani. A fost ultimul care a fost ingropat aici. Ultima voi fi eu,” spune doamna Gagesch si ni se pare ca in glasul ei rasuna si un pic de mandrie. “Toti ceilalti sasi au plecat, multi nu mai traiesc, odihnesc undeva in Germania. Dar eu raman aici, cu tiganii care sunt acum in casele noastre, cu Hansi al meu, care ma apara. Pe toti cainii nostri i-a chemat Hansi. Ce sa caute o batrana ca mine in alta parte?”
Mai tarziu mergem la cimitirul german, ce se gaseste pe o colina scunda. Drumul urca pe o panta si doamna Gagesch trebuie sa stea pe loc de cateva ori, ca sa-si traga sufletul. “E din ce in ce mai greu, dar, pe ultimul drum, nu mai trebuie sa mergi pe picioare, atunci esti carat de altii,” spune ea.
Trecem pe langa morminte prin iarba inalta si tot mereu doamna Gagesch se opreste si povesteste ceva despre un barbat, despre o familie, o femeie, care sunt ingropati aici. Unul a trait ani de zile cu o fata romanca din satul vecin, a fost o “dragoste salbatica”, pentru ca el avea nevasta si copii, dar acum sunt cu totii morti de mult, iar copiii traiesc in Germania. Urmatorul stia sa cante minunat la acordeon, in rest nu prea a invatat el multe, s-a insurat cu fata bogatasului Müller, dar a trebuit apoi sa mearga la razboi si a murit pe undeva prin Ural, unde o fi asta nu se stie precis, oricum, nu s-a mai intors si tanara vaduva a inceput sa bea si, de atata suparari, s-a aruncat in fantana.
Apoi am ajuns la Treni si Kathi, cele mai frumoase doua fete din sat, Treni cea bruneta, cu parul carliontat, blonda Kathi cu frizura ei de Gretchen, amandoua rad dintr-un tablou oval de portelan, ca si cum s-ar bucura ca le vizitam. Era inainte de deportari si, pe atunci, inca mai radeau si dansau. Trei ani au fost plecate, s-au intors bolnave si distruse ca sa moara aici incetul cu incetul. Se spunea ca avusesera pneumoconoiza, caci muncisera intr-o mina.
Apoi, cativa pasi mai incolo, ascultam povestea invatatorului Zakel, cu mustata lui fluturanda, care a predat patruzeci de ani si care era la fel de destept ca si preotul. Privirea lui indreptata spre posteritate este tot dura si impozanta. Multi dintre elevii sai au facut mai apoi studii, au devenit celebri si, acum, traiesc in Germania. El a fost ultimul invatator care putea sa le dea copiilor cate o mama de bataie; asa cerusera parintii si, de aceea, pedeapsa cu bataia s-a desfiintat aici abia dupa moartea lui Zakel. Pe atunci abia mai existau copii germani, iar pe romani si pe tigani nu-i puteai bate chiar asa.
Este o poveste fara sfarsit, care ne face sa ne oprim la multe morminte. Auzim despre oameni pe care nu i-am vazut niciodata si pe care-i cunoastem acum, dupa ce au parasit aceasta lume; si pare ca, deodata, s-a strans aici tot satul. In fata unei pietre funerare de granit se ingramadesc multe floricele rosii: “Acesta este mormantul nostru, barbatul meu odihneste in alta parte, in Serbia.” Mai multe nu ne spune. Sub numele barbatului sunt cioplite data nasterii si cea a mortii. Dedesubt, numele doamnei Gagesch si data nasterii ei, langa este putin loc pentru data decesului.
Mormintele sunt astfel dispuse incat privesc in jos, in vale. Valea se termina in strada, totusi, in spate, mai sunt alte vai linistite, alte sate tacute cu biserici inchise si case prin al caror acoperis luna priveste noaptea in odai goale.
“Tara sasilor,”, spune doamna Gagesch si este ca si cum ar spune acum asta, deoarece Birkendorf se afla in pamant. “Tara sasilor a ramas aici – campurile, pajistile, muntii. Numai sasii s-au mutat.”
Invatatoarea din Birkendorf staruie ganditoare asupra ultimei ei bucatele de tara a sasilor. Tocmai a tinut o ora de cunostintele patriei in fata a doi straini de loc si, acum, se sprijina putin epuizata de piatra de mormant a unui prieten din tinerete, cu care i-ar fi placut sa se marite, daca ea n-ar fi fost atat de saraca, iar el atat de bogat si nu este singurul barbat pe care-l pomeneste cu durere. Intre timp, parul i-a incaruntit precum iarba tomnatica de langa sumedenia de morminte, iar paltonul ei negru aminteste de penajul ciorilor ratacite, care tocmai se pierd intr-un zbor tacut in seara.
Totusi, mortii nu se mai intorc, chiar daca, uneori, sunt rechemati din amintirile pastrate cu grija si prezentati celor in viata. Candva, nu va mai intreba nimeni de ei. Ne-a fost doar putin dor si de aceea am adastat in valea aceasta, putin dor de basmele si legendele casei, care au locuit aici, odinioara, in memoria oamenilor, dar si aceste povesti au amutit de mult-povestile unei lungi povesti.
Ceea ce va ramane, atunci cand, intr-o zi linistita, dupa o ultima poveste, se va fi inchis si gura invatatoarei din Birkendorf, va fi un cantec stins despre “tara binecuvantata” din Carpati – necantat si neauzit.
Vom mutigen Aaron
Vom Sched und dem Engel
(Vom Teufel und dem Engel)
Feinen, rumänisch Faina – das ist ein kleiner Ort oben im Wassertal, gerade neun Holzkulibn stehn dort, mehr nicht, und nahe am Wald gibt es die Holzkapelle „Zur Heiligen Elisabeth“. In Feinen da hat einst gelebt eine Frau, die hat geheißen Katalin Kasomir, und die ist geworden hundertdrei Jahre alt. Sie war die Frau vom Stefan Kasomir, dem Forstgehilfen. Der Stefan – wir haben ihn geheißen Stefku –, der hat noch langes Schulterhaar getragen, so wie die Männer früher, und jeden Tag hat er es ein wenig mit Butter eingeschmiert; damit es dann so schön glänzt. Wenn er vielleicht einmal im Jahr nach Oberwischau kam, lachte man über ihn: „Scheen wie a Tokn“ (schön wie eine Puppe), sagten die Leute. Damals trugen die meisten Männer schon kurzes Haar, so wie heute.
Die Katalin – wir haben sie genannt Kathku, das ist die Zipser Form, denn sie war, glaub ich, eigentlich eine Zipserin –, die Kathku also, die hat hundertdrei Jahre nur oben im Wald gelebt; die ist nie heruntergekommen ins Dorf. Ihr Leben lang hat sie immer nur Malina gegessen und Mamaliga mit Brinsen oder mit Kuhkas, manchmal gebratene Forellen aus dem Fluß, und sie hat viel Schofmillich getrunken, und auch Mineralwasser aus der Quelle, denn das fließt den ganzen Tag und kostet nichts.
So hat die Kathku gelebt.
Der Stefku ist nur etwas über neunzig geworden, denn der hat öfters – wie das so die Art der Männer ist – ein paar Gläser Horinka getrunken; und wenn ich sag Gläser, so waren das Wassergläser, und nicht solche kleine Fingerhüterl, wie es sie in der Stadt gibt. Und dann hat der Stefku auch viel geraucht, storkn Dohan, und seine Zähne waren immer ein wenig gelb vom Djegechz. So ist er den ganzen Tag herumgegangen: mit Botschkor an den Füßen, mit Gatjahosn, dem Pelzlaibl, mit glänzendem Haar und die Pipke im Mund.
Ich glaub, er ist so dreiundneunzig geworden, und die Kathku war noch ziemlich „jung“, sie war erst über die achtzig hinaus. Und nach dem Begräbnis haben die Leute gefragt: „Na, Kathku, wirst jetzet pleiben allan, a Witwin?“ Und sie hat geantwortet: „Werd ichs mir noch ieberdenken, hob ja noch a Zeit.“
Aber geheiratet hat sie dann doch nicht wieder. Das Einzige, was noch war, sagt man: Sie hat es getrieben mit der wildn Lieb. Was das ist? Heute den einen, morgen den andern. Viele werden es aber nicht mehr gewesen sein.
Immer wenn ich oben in Feinen war, hab ich die Kathku besucht, und sie hat sich jedesmal auch sehr gefreut, weil von mir hat sie dann hören können, was es noch Neues gibt – draußen in der Welt, also in Oberwischau. Denn weiter als bis Unterwischau bin auch ich nie gekommen. Warum auch? Hier gab es ja alles, was man zum Leben braucht. Warum soll man dann hinausgehen in andere Orte, zu anderen Menschen, die man nicht kennt, und die einen vielleicht böse anschauen, weil man dort fremd ist. Nein, Oberwischau, das war meine Welt, und so ist es auch heute noch.
Wenn ich bei der Kathku war, hab ich immer getrunken ein paar Teppa Malinasaft mit Borkutwasser. Dann bin ich gesessen bei ihr so eine Stund, oder auch zwei, und manchmal hat sie mir erzählt eine neue Mära, die sie gerade vorher gehört hatte – von einem anderen Besucher, denn zu ihr kamen immer irgendwelche Leute. Manche kauften auch nur Malina oder Schofbrinsn. Und weil sie alle Sprachen kannte hier aus dem Tal: zipserisch, also deutsch am besten, dann auch rußnakisch, walochisch, madjarisch und jiddisch, weil es gab damals viele Juden, und das waren Fuhrleut, die das Holz ins Tal transportierten, wenn man nicht flößen konnte.
Da sagt sie einmal: „Bebu, gestern hob i gheert a jiddische Kschichten, a Maise, vum Schamu, wos fiehrt die Peimer ins Tol.“
Frag ich noch: „Schamu, der Rote?“ Denn damals gab es hier einen Fuhrmann, Schamu Goldner, der hatte einen langen roten Bart, deshalb hieß er auch Schamu der Rote“.
Antwortet die Kathku: „Nein, des is Schamu der Schworze, weil der hat a schworzn Port“.
Sag ich: „Derzähl sie mir.“
Und da hat sie erzählt die Maise „Vom bösen Sched und dem guten Engel“.
Und die beginnt so:
Es war einmal vor sehr langer Zeit, vielleicht vor hundert Jahren, und da lebte in einem kleinen Dorf – damals sagte man Jischuw –, also da lebte ein alter Jud, und der war Koschokar, wie man hier die Kürschner nennt. Das ist auch heute noch eine gute Sache, denn Koschoks brauchen die Leute, im Winter ist es immer noch sehr kalt, hier in den Karpaten, und so wird es wohl auch bleiben.
Eines schönen Tages kam zum Jossel – so hieß der Koschokar – ein fremder Mann, ein Städtischer, kein Jischuwnik, denn er war gekleidet wie die Herren aus der Stadt. Und er sagte zum Jossel: „Näh mir einen Koschok aus Fellen von schwarzen Lämmchen. Aber du darfst nur am Sonntag arbeiten, und nicht an einem anderen Tag, und du musst die Arbeit immer sofort beenden, wenn man die ersten Sterne sehen kann. Ich werde dich dafür sehr gut bezahlen.“
Der Jossel wunderte sich ein wenig über den seltsamen Mann und seine besonderen Wünsche, doch dann nahm er die Komanda an: „Gut, ich werd Euch nähen einen solchen Koschok.“ Er nahm die Maße, wie auch sonst bei Bestellungen, dann vereinbarten sie den Preis, und das war vielleicht dreimal mehr, als man sonst für einen Koschok zahlte.
Was aber der Jossel nicht wusste: Der neue Klient war kein anderer als der Sched, ein Bruder vom Teufel, vom Tajbu, wie die Zipser sagen. Der Sched aber kann, wie ein Kischef-macher, vielerlei Gestalten annehmen – mal erscheint er als schwarzer Hund, dann als schwarze Katze, oder auch als schöne böse Frau, immer in städtischem Gewand und, wie es diesmal war, als feiner Gwir. Die Juden glaubten auch – das wusste die Kathku vom Schamu, und das hat er nur ihr gesagt –, die Juden glaubten auch damals, dass der Sched immer ausschaut wie ein Goj oder wie ein Jahudi, denn zwischen den beiden gibt es kaum noch einen Unterschied.
Was der gute Jossel außerdem nicht wusste: Wenn du einmal für den Sched arbeitest, bleibst du nachher sein Schames, sein Diener, und davon kommt man sein Leben lang nicht mehr los. Dann muß man für den Sched roboten, und nicht nur am Sonntag, der ja für die Juden nur ein Wochentag ist, sondern auch am Schabbes. So versucht nämlich der Sched, aus dem Juden einen Goj zu machen; und das heißt man: er muss sich iberkehren den Pelz. Und so wird der Mensch schließlich wie ein Scherez, ein Kriechtier, auf das der Sched treten kann, und eines Tages tritt er es einfach tot.
Der Sched aber erscheint oft, wenn das Jahr zu Ende geht, das ist im Monat Elel; bei den Christen aber beginnt dann erst gerade der Herbst.
Am nächsten Tag, nachdem Jossel das Schachreß gesprochen hatte, erschien ihm plötzlich ein guter Engel. Dieser war weder Mann noch Frau, und er trug eine lange weiße Kapote, die bis zum Boden reichte. So stand er plötzlich vor dem Jossel, und der war ein wenig erschreckt, muß man sagen, denn er hatte noch nie einen Engel gesehen.
Der Engel aber sprach mit feiner, leiser Stimme: „Bei dir war gestern einer von den Schejdim. Der hat einen Koschok bestellt. Wirst du ihm den Koschok nähen, bist du nachher für immer sein Diener, sein Schojte, mit dem er machen kann, was er will.“
Da bekam Jossel einen großen Schreck, denn der Engel hatte onwarfn a Mojre af ihn, wie man hier im Volk sagt, er hatte ihm kalte Angst eingejagt.
„Was muss ich tun, damit der Sched mich in Ruhe lässt?“ fragte Jossel und zitterte am ganzen Guf.
„Wenn er wieder kommt,“ sagte der Engel, „zeig ihm einige schwarze Felle, aus denen du den Koschok nähen willst. Leg aber auch ein weißes Lammfell darunter. Dieses muß sein von einem Milchtier, das nicht älter wurde als sieben Tage. Leg das weiße Fell so hin, daß er es anfassen wird. Das weitere ergibt sich dann von selbst.“
Es vergingen vielleicht vierzehn Tage, und der Jossel hatte sich schon die Felle beschafft, als plötzlich eines Tages der Sched vor der Tür stand. „Zeig mir, was du inzwischen gearbeitet hast!“ rief er ungeduldig.
„Ich hab die Felle vorbereitet,“ sagte der Jossel. „Hier sind sie, sauber und schön weich.“
Der Sched griff hastig nach den Lammfellen, strich mit der Hand kosend darüber, und plötzlich glitten seine Finger auch über das weiße Fellchen, das sich unter den schwarzen befand.
Oj, da hättest du hören sollen, die Jelole aus dem Mojl vom Sched – als würde man einem Chaj den Schwanz abschneiden, genau so klang das! Und dann ließ er die Felle liegen und sprang hinaus, flink wie ein junger Hund, hinter dem der Schinder her ist. Und er lief davon zum Jischuw hinaus bis zu den fernen Bergen, wo er im dunklen Wald verschwand.
Am nächsten Morgen aber, nach dem Schachreß, erschien wieder der gute Engel, und bevor sich Jossel bedanken wollte, sprach er: „Bedank dich nicht bei mir, denn ich bin nur ein Bote. Mich hat der Ojberschte geschickt, gelobt sei sein Name. Aber nun musst du alle Felle, die der Sched angefaßt hat, verbrennen, denn nur dann kann der böse Geist dir nichts mehr antun.“
Selbstverständlich befolgte Jossel den Rat des guten Engels und lebte seither in Frieden. Kein Jejzer, kein Ruech, kein Prikulitsch und auch kein Sched hat ihm etwas antun können.
Damals hab ich mich gefragt: Warum kommen die Engel nur zu den Juden? Denn ich hab dann noch andere Maises gehört, wo auch von Engeln die Rede war. Kann es sein, dass die Juden auch da eine bessere Farbindung haben? Als der Schamu wieder einmal herauf ins Tal kam, hab ich ihn gefragt: Warum kommen in den Maises die Engel immer nur zu euch, zu den Juden?
„Das musst du einen Engel fragen,“ sagte Schamu. „Ich selbst kenn keinen Engel, und ich hab auch noch keinen gesehn.“
„Her nach Feinen wird aber kein Engel kommen“, hab ich ihm geantwortet.
„Das möchte ich auch glauben“, hat Schamu gesagt, „weil Feinen ist viel zu weit weg.“
„Weit weg von wo?“ hab ich gefragt.
„Weit weg von der Welt“, hat Schamu gemeint. Und da hatte er leider recht.
Worterklärungen
Holzkulibn = Holzhütte; Brinsen = Käse; Malina = Brombeeren; Horinka = Schnaps; Dohan = Tabak; Djegechz = Teer; Botschkor = Stiefelschuhe; Gatjahosn = lange, weiße Hosen; Pipke = Tabakpfeife; Teppa = Töpfchen; Borkutwasser = Mineralwasser; Schofbrinsn = Schafkäse; Jischuw = Dorf, Siedlung; Koschok = Pelzjacke; Tajbu = Teufel; Gwir = reicher Mann; Jahudi = städtischer Jude; Sched = böser Geist, Teufel; Schames = Synagogendiener; Schachreß = Morgengebet; Ojberschte = Oberste (Gott); Schejdim = böse Geister, Teufel; Schojte = Narr, Clown; Guf = Körper; Mojl = Maul; Jelole = Gejammer; Chaj = Tier; Ruech = Teufel, Dämon; Prikulitsch = Wehrwolf.
(Aus dem Band Aaron cel curajos / Vom mutigen Aaron – zweisprachige Ausgabe. Hasefer Verlag: Bukarest, 2008.)
Ostjüdische Märchen
Mojsches Urteil
Einmal hielt sich der weise Mojsche Tscherteser in der schönen Stadt Sigeth auf. Da sah er, daß viel Volk zum Gericht strömte, und so ging auch er hin, um zu hören, wie da Recht gesprochen wird.
Was war geschehen?
Ein armer Mann hatte einen reichen Händler bestohlen, als beide in einer Kotschma saßen. Der Reiche hatte sich betrunken und war dann, wie das so ist, auf dem Stuhl eingeschlafen. Der Arme aber hatte nur wenig getrunken, weil sein Geld nicht gereicht hätte, um eine höhere Zeche zu bezahlen. So blieb er beinahe nüchtern.
Als er nun merkte, dass der Schlafende eine kostbare Golduhr bei sich trug, nahm er sie ihm einfach weg und verschwand damit. Er wurde jedoch bald gefaßt und stand jetzt vor Gericht.
Als der Richter unter den Anwesenden den Weisen erkannte, bat er ihn, er solle an seiner Stelle das Urteil fällen.
Mojsche überlegte ein wenig, dann sprach er den reichen Händler schuldig; die Uhr solle ihm der arme Dieb zurückgeben, dafür aber müsse er vom Reichen mit einer Summe Geld entschädigt werden.
Über dieses Urteil war der Richter sehr verwundert und das anwesende Bauernvolk – Rumänen, Ruthenen, Ungarn und Schwaben – schimpfte laut und verlangte, man solle doch den Juden davonjagen, weil er ja keine Ahnung von Recht habe.
„Erkläre uns bitte, warum du dieses Urteil so gefällt hast“, sagte der Richter und forderte das bunte Publikum auf, sich ruhig zu verhalten.
Darauf antwortete Mojsche:
„In der Nähe meiner Hütte wohnt eine Elster. Sie hat ihr Nest auf einem Baum, und von dort kann sie in die Höfe der Nachbarn spähen. Wenn sie etwas sieht, das glänzt und aus Metall ist, kommt sie geschwind geflogen und trägt es fort. Darum nennt man sie auch eine ‚coţofană hoaţă’, eine diebische Elster. Aber zur Diebin wird sie erst durch die Unachtsamkeit der Menschen. Seht, mich hat diese Elster noch nie bestohlen, weil ich ihr einfach keine Gelegenheit dazu gebe. Ich lasse nichts liegen, was glänzt. Und so ist für mich diese Elster ein ehrliches Tier, und so wird es auch bleiben. Hätte der reiche Händler sich nicht leichtsinnig betrunken und seine protzige Golduhr nicht sichtbar bei sich getragen, wäre dieser arme Teufel vielleicht niemals auf den Gedanken gekommen, ihn zu bestehlen. Gelegenheit macht Diebe.“
Der Richter war mit dieser Begründung einverstanden und bekräftigte das Urteil; und das Volk, das zuvor noch mit bösen Worten nicht gespart hatte, lobte nun den Weisen.
Der aber sah, daß er wieder heim in seine Hütte kam und dachte bei sich: „Wehe dem, der auf die Gerechtigkeit des Volkes angewiesen ist…“
Dazu auf Seite 296 der Kommentar des Volkserzählers Schtrul Klein, genannt „Schtruli“, Bauer in Certeze (dt. Neudorf, Sathmarland/Rumänien), 1978: „… das soll heißen, daß das Volk oft so urteilt, wie es ihm gefällt. Das soll nun nicht heißen, daß die Obrigen besser sind! Bei Gott, sie sind es auch nicht! Aber das Volk, auch hier im Dorf, ist manchmal ganz schön neidisch auf unsereinen, besonders dann, wenn er vielleicht einen Topf Fleisch mehr auf dem Tisch hat (…).“
(Aus dem Band: Ostjüdische Märchen. Gesammelt, übersetzt und herausgegeben von Claus Stephani. Eugen Diederichs Verlag, München 1998. Reihe Die Märchen der Weltliteratur.)